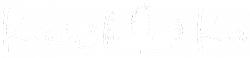- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Hintergrundwissen
In der Konzeptarbeit hat uns die Recherche in Mythologie und Anthropologie in viele alte und neue Welten geführt. Auf vielen verzweigten Wegen haben wir den Hafen für unsere Geschichte um KASCH & KA schlussendlich im südlichsten Teil der Welt, wo es menschliches Leben gibt, am Tor zum ewigen Eis gefunden.
Ausgehend von den Mythen und der Kultur der Yamana, einem Wassernomadenvolk im Süden Feuerlands, welches sich vor neuntausend Jahren hier ansiedelte, entwickelt sich eine Erzählung, der die Ausrottung der indigenen Bevölkerungsgruppe und geschichtliche Fakten einem Rahmen geben. In Südamerika nehmen Brüder- und insbesondere Zwillingspaare eine wichtige Rolle in der Mythologie ein und wurden vielfach als Kulturbringer für das eigene Volk benannt, so auch bei den Yámana.
Die hier veröffentlichten Informationen sind nur ein erster kleiner Auszug für interessierte Leser dieser Website und Hörer unserer Hörtheaterproduktion. Wir haben hunderte Bücher und digitale Medien, auch Originalmaterial in Audio- und Videoformaten, studieren dürfen. Für die Hilfe bei der Recherche und Zusendung sind wir sehr dankbar.
Ausgehend von den Mythen und der Kultur der Yamana, einem Wassernomadenvolk im Süden Feuerlands, welches sich vor neuntausend Jahren hier ansiedelte, entwickelt sich eine Erzählung, der die Ausrottung der indigenen Bevölkerungsgruppe und geschichtliche Fakten einem Rahmen geben. In Südamerika nehmen Brüder- und insbesondere Zwillingspaare eine wichtige Rolle in der Mythologie ein und wurden vielfach als Kulturbringer für das eigene Volk benannt, so auch bei den Yámana.
Die hier veröffentlichten Informationen sind nur ein erster kleiner Auszug für interessierte Leser dieser Website und Hörer unserer Hörtheaterproduktion. Wir haben hunderte Bücher und digitale Medien, auch Originalmaterial in Audio- und Videoformaten, studieren dürfen. Für die Hilfe bei der Recherche und Zusendung sind wir sehr dankbar.
Und so beginnt unser Märchen:
„An einem der weitentlegenen Enden unserer Welt, am Fuße der steinernen Riesen, die den Himmel seit Millionen Jahren tragen, wurden einst, in der kleinen Ansiedelung der Yámana, in einer Kate aus Ästen und Zweigen, Zwillingsbrüder geboren.
Von den Häuptern der steinernen Riesen fiel die Nacht hinunter in das Tal. In dieser Nacht kehrten die schwarzen Kondore nicht wie gewohnt hinauf in die Kronen der felsigen und vereisten Giganten zurück, dorthin, wo sie ihre Nester gebaut. In dieser ungewöhnlichen Nacht entfernten sie sich nicht von den Menschen und blieben auf den Dächern der Behausungen, in Bäumen, auf Felsen und Pfaden. Nur nah, ganz nah an jenem Ort, an dem die beiden Knaben im Kindbett an ihrer Mutter Busen lagen.
An jenem Kindbett war kein Glück zu Gast.
Die Frischgeborenen entfachten in den Menschen eine sie alles ausfüllende Angst, eine ihnen bis dahin unbekannte finstre Macht.“
„An einem der weitentlegenen Enden unserer Welt, am Fuße der steinernen Riesen, die den Himmel seit Millionen Jahren tragen, wurden einst, in der kleinen Ansiedelung der Yámana, in einer Kate aus Ästen und Zweigen, Zwillingsbrüder geboren.
Von den Häuptern der steinernen Riesen fiel die Nacht hinunter in das Tal. In dieser Nacht kehrten die schwarzen Kondore nicht wie gewohnt hinauf in die Kronen der felsigen und vereisten Giganten zurück, dorthin, wo sie ihre Nester gebaut. In dieser ungewöhnlichen Nacht entfernten sie sich nicht von den Menschen und blieben auf den Dächern der Behausungen, in Bäumen, auf Felsen und Pfaden. Nur nah, ganz nah an jenem Ort, an dem die beiden Knaben im Kindbett an ihrer Mutter Busen lagen.
An jenem Kindbett war kein Glück zu Gast.
Die Frischgeborenen entfachten in den Menschen eine sie alles ausfüllende Angst, eine ihnen bis dahin unbekannte finstre Macht.“
Auszug aus dem Hörtheaterstück, von Dirk Grünig

Patagonien
Patagonien, im Süden des Lateinamerikanischen Kontinentes gelegen, ist landschaftlich von den Hoch- und Mittelgebirgszügen der Anden sowie einer im Argentinischen Teil liegenden Hochebene und dem Hochland von Patagonien geprägt.Im Norden begrenzt durch die beiden Flüsse Colorado in Argentinien und dem Rio Bío Bío in Chile reicht es im Süden bis an die Magellanstraße, die es von den Inseln des Feuerlandes trennt. Feuerland wird – je nach Quelle - als Teil Patagoniens oder als eigenständiges Gebiet bezeichnet.
Patagonien ist mit einer Bevölkerungsdichte von ca. zwei Einwohnern pro Quadratkilometer, sehr dünn besiedelt.
Neben den Gebirgszügen der Anden ist die trockene, fast unbesiedelte Hochebene landschaftlich charakteristisch. Der chilenische Teil Patagoniens wird von dem feuchten, kühlen Klima geprägt. Der im Regenschatten der Anden liegende argentinische Teil ist sehr trocken. Charakteristisch für diese Region ist der immerwährende starke Wind. Das chilenische Inlandeis ist die größte zusammenhängende Eismasse außerhalb der beiden Pole und Grönlands.
Charakteristische Vertreter der patagonischen Tierwelt sind in den Wüstensteppen das Guanako, die Patagonische Beutelratte, das Patagonische Stinktier sowie der nur noch selten vorkommende Puma. Typisch für die Südanden sind der Andenhirsch, der Pudu (Zwerghirsch), der Andenkondor, der auffällige Magellanspecht in den Wäldern und der Magallan-Pinguin an den felsigen Küsten.
Patagonien ist ein beliebtes Reiseziel. Wirtschaftlich ist der Tourismus im chilenischen Teil die Haupteinnahmequelle. In den Fjorden auf der chilenischen Seite Patagoniens werden intensiv Fischzucht und Aquakulturen mit Lachs, Muscheln und Krustentieren, auch für den europäischen Markt, betrieben. Wirtschaftlich bedeutend auf der argentinischen Seite sind zudem: die stationär-extensive Schafzucht auf Naturweiden, die Erdöl- & Kohleförderung, die Stromerzeugung und der Obstanbau.
Feuerland
Der Name „Feuerland“ bzw. „Tierre del Fuego“ (Land des Feuers) stammt vermutlich von Ferdinand Magellan, der 1520 bei der Erkundung der später nach ihm benannten Magellanstraße vom Schiff aus viele Feuer der nomadisch lebenden Ureinwohner sah.Die an der Südspitze Lateinamerikas gelegene Inselgruppe, die durch die Magellanstraße vom Festland getrennt ist, hat eine Landfläche von 73.746 km²; davon entfallen 47.000 km² auf die Hauptinsel Isla Grande de Tierra del Fuego. 1881 wurde Feuerland durch einen Grenzvertrag zwischen Chile und Argentinien aufgeteilt. Der östlichen Teil, die heutige Provinz „Tierra del Fuego“ fiel an Argentinien, der westlichen Teil (heute die Region „Magallanes“) an Chile.
„FEUERLAND heißt das zerrissene Inselgewirr im äußersten Süden der neuen Welt. Sein fernster Punkt ist das von ewig unruhigen Wellen umbrandete Kap Hoorn und seine Nordgrenze bildet die von Ost nach West verlaufende Magellan-Straße. Hier befuhren an der Westküste einst die Yamana mit ihren Rindenbooten die zahlreichen Kanäle entlang…“. So beschrieb Martin Gusinde Feuerland in seinem Buch „Nordwind – Südwind“, Mythen & Märchen der Feuerlandindianer.
Auf Feuerland lebten vier Gruppen von indigenen Völkern, die sich vor tausenden Jahren hier ansiedelten: die Landnomaden der Ona (Selk’nam) und der Haush (Manek'enk), die im Landesinneren beziehungsweise im Südosten der Hauptinsel siedelten, sowie die Seenomaden der Kawesqar (Alacalufes) und der Yámana (Yaghan), die am westlichen und südlichen Küstenstreifen lebten. Die Gesamtanzahl der einzelnen Bevölkerungsgruppen kann aufgrund ihrer Lebensweise als Jäger und Sammler für das 17. Jahrhundert auf insgesamt 12.000 geschätzt werden.

Verbreitung vorspanischer Völker in Südpatagonien
abgeleitete Arbeit: Janitoalevic
Datei: Pueblos indigenas de Chile-ver.svg

Der Andenkondor
Der Andenkondor besitzt im gesamten Lateinamerikanischen Raum eine hohe mythologische Bedeutung und ist u.a. das Wappentier von Chile, Ecuador, Bolivien und Kolumbien.
Mit Flügelspannweiten von über 3 m, einer Körpergröße von ca. 1 m bis 1,20 m, und einem Gewicht von bis zu 15 kg zählen die Andenkondore nach dem Albatros zu den größten flugfähigen Vogelarten.
Der Kondor nutzt für seinen Flug Aufwinde und kann auf Nahrungssuche bis zu 300 Kilometer pro Tag in extremen Flughöhen von bis zu 7.000 Metern zurücklegen. Sie erreichen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 55 km/h.
Ausgewachsene Andenkondore haben ein schwarzes, glänzendes Gefieder und einen weißen Kragen bzw. ein Flaumgefieder am Halsansatz. An der Oberseite der gefingerten Schwingen besitzen sie einzelne weiße bis silberfarbene Federn.Ihr ungewöhnliches Äußeres mit nacktem Hals und Kopf ist vermutlich eine hygienische Anpassung der Aasfresser, da die nackte Haut leichter sauber und trocken zu halten ist.
Die Schnäbel sind kurz und kräftig mit einem hackenförmigen Ende und an der Kopfoberseite tragen sie einen wulstigen Kamm.
Ihr Verbreitungsgebiet liegt zwischen Peru und Feuerland. Obgleich sie zumeist in einer Höhe von 1.000 – 5.000 m vorkommen, sind sie in den Küstenregionen z.T. auch unmittelbar am Meer anzutreffen, wo sie sich als Aasfresser von gestrandeten Walen und toten Robben ernähren.
Die Kommunikation der Kondore erfolgt vor allem über Körpersprache. Lautäußerungen werden durch Zungen- und Schnabelbewegungen sowie durch schnelles, gepresstes Luftausstoßen erzeugt, wobei u.a. heiser keuchende und krächzende Laute entstehen.
Biologisch zählt der Andenkondor (Vultur gryphus) zu den Neuweltgeiern. Die Art gilt aufgrund menschlicher Verfolgung, Vergiftungen sowie den Verlust des Lebensraumes als bedroht.

Gruppe von Yámana um 1882
William Singer Barclay - acervo do Museu Marítimo de Ushuaia
Die Yamana
Die Yámana (auch: Yagan oder Yaghan) waren eine der vier ethnischen Gruppen, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Wassernomaden entlang des Beagle-Kanals und der benachbarten Kanäle, von der Halbinsel Brecknock bis zu den Wollaston-Inseln bei Kap Hoorn, auf Feuerland siedelten.Für sie war das Kanu Lebensmittelpunkt: in ihnen transportierten die Familien ihren gesamten Besitz, ebenso wurde eine Feuerstelle von einem Rastplatz zum anderen mitgenommen. Wenn sie an Land lagerten, lebten die Yámana in niedrigen Hütten, die aus Baumästen gefertigt wurden, und je nach Jahreszeit aufgrund der unterschiedlichen Witterung ihre Form änderten. Über Jahrhunderte lagerten die Yámana an bevorzugten Lagerplätzen, die von Bergen aufgebrochener Muscheln umgeben waren. Während die Männer für die Jagd verantwortlich waren, tauchten die Frauen im eiskalten Wasser nach Muscheln und Krebsen.
Das Yaghan, auch Háusi Kúta, ist eine der indigenen Sprachen Feuerlands und wurde von den Yámana gesprochen. Das Guinness-Buch der Rekorde führt das Yaghan-Wort mamihlapinatapai (dt.: „das Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist, zu tun“) als das „prägnanteste Wort“ und als eines der am schwierigsten zu übersetzen.
Die Yámana glaubten an ein höchstes Wesen, das allerdings kein Schöpfer war, aber den Menschen, Pflanzen und Tieren das Leben geschenkt hatte und sie beteten diesen Hochgott Vatauineva („der Alte, Unveränderliche, Ewige“) an. Als Herr über Leben und Tod stand er über allen Geistern und bestrafte Missetaten, meist mit einem frühen Tod. Sie kannten zudem zwei Zwillingspaare als Kulturbringer. Auch der Glaube an Naturgeister war weit verbreitet.
Die ersten Europäer, die den Yámana begegneten, waren die Seeleute einer holländischen Expedition um 1624 bei Kap Hoorn. Zu vermehrten Kontakten zwischen Europäern und Yámana kam es erst mit dem Aufkommen der Schnellsegler und der Waljagd Ende des 18. Jahrhunderts. In Europa bekannt wurden jene vier Yámana, die im Zuge der Expedition von Parker King und Robert Fitz Roy in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach England verschleppt wurden, als Jemmy Button, Fuegia Basket, Boat Memory und York Minster.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu regelmäßigen Kontakten, etwa durch die Missionierung der South American Missionary Society. Bei Ankunft der ersten Siedler um 1884 brach allerdings eine Masernepidemie aus, die fast die Hälfte der insgesamt auf 1000 Personen geschätzten Yámana tötete. Ebenso trug die durch Missionare (v.a. South American Missionary Society & Salesianer Don Boscos) überlassene Kleidung zur Ausbreitung der Epidemie bei. Die nunmehr forcierte sesshafte Lebensweise und der Wechsel der Ernährungsweise (von vorrangig tierischen Fetten zu pflanzlichen Produkten) verschärfte den schlechten Gesundheitszustand der Überlebenden (Skrofulose, Lungenentzündung und Tuberkulose).
Ausrottung der Feuerland-Indigenen
Die Yámana, ebenso wie die anderen Ureinwohner Feuerlands, die Haush, die Ona (Selk’nam) und die Kawesqar (Halakwúlup), wurden im Zuge der Besiedelung durch weiße Siedler bereits Anfang des 20. Jahrhunderts fast vollständig ausgerottet.Mit der Missionierung der Region ab 1850 durch katholische und anglikanische Missionsstationen wurden die Yámana vor allem Opfer von Infektionskrankheiten. Tuberkulose und Masernepidemie zählten zu den häufigsten Krankheiten, die bis unzählige Menschen das Leben kostete. Um 1911 lebten deshalb nur noch rund 100 Yámana (von zuvor 3000 im Jahr 1834). 1953 wurden sie von der chilenischen Regierung zwangsumgesiedelt. Die letzte Yámana, Rosa Yagan Yagan, die noch relativ stark den ursprünglichen Lebensstil pflegte, starb 1983.
Den Ona (Selk`nam) widerfuhr ein anderes schreckliches Schicksal. Ab etwa 1850 begann die dauerhafte Besiedelung der Isla Grande durch Einwanderer aus Argentinien, Chile und Europa. In den folgenden Jahrzehnten wurde ein Großteil der dort lebenden ca. 2000 Selk’nam entweder von den Einwanderern ermordet oder kam indirekt durch Hunger oder Krankheiten zu Tode.
Als erstes kamen die Goldsucher, die äußerst gewaltsam gegen die Ona (Selk’nam) vorgingen. Bekannt wurde i.B.die Mordbande um Julio Popper. Ab 1878 expandierte die Schafzucht in die unbewaldete Pampa im Norden, was für die Ona (Selk’nam) eine existentielle Bedrohung ihrer Lebensgrundlage bedeutete. Der Konflikt zwischen Schafzüchtern und Ona (Selk’nam) eskalierte am Ende des 19. Jahrhunderts: von vielen Schafzüchtern wurde eine Prämie von einem Pfund Sterling Kopfpreis pro Abschuss eines Ona (Selk’nam) ausgesetzt. Das Londoner Anthropologische Museum bezahlte gar acht Pfund Sterling für den Kopf eines Feuerländers. Die chilenischen Unternehmer Mauricio und Sara Braun, José Menéndez und dessen Gutsverwalter Alexander McLennan leisteten der Vernichtung der Ona (Selk’nam) weiteren Vorschub.
Im Weiteren kamen Missionare, darunter ab 1887 auch die Salesianer Don Boscos. Trotz bester Absichten wurden die Missionare zum Beschleuniger des Genozids. Sie griffen in die kulturelle Selbstverwaltung der Ona (Selk’nam) ein und etablierten westliche Traditionen, die nicht hilfreich für das Überleben im Feuerland waren. 1911 lebten noch etwa 300 Selk’nam in Reservaten (von zuvor 2000 um 1834), aber eine Masern-Epidemie im Jahre 1925 tötete den Großteil dieser Menschen. 1966, 1969 und 1974 starben drei letzte bekannte Ona (Selk’nam): Esteban Yshton, Lola Kiepje und Ángela Loij.

Julio Popper neben einem ermordeten Ona (Selk’nam).
Autor/-in unbekannt, available at
The Museum of World Cutlure (Världskulturmuseet) as no 008218

KASCH & KA, Zeichnung: C. Grünig
Zwillingspaar als Kulturbringer in der südamerikanischen Mythologie
Die Brüder- beziehungsweise Zwillingspaarmythen erfreuen sich in Polynesien und in Amerika einer weiten Verbreitung.Übereinstimmend mit jenen Indianern findet man auch bei den Yamana die Anerkennung eines Höchsten Wesens, das als reiner Geist betrachtet wird; …als Besitzer aller sichtbaren Dinge gilt. Groß ist der Reichtum an Mythen, welche die Yamana sich gern und oft erzählen. Wenn auch das Höchste Wesen, namens Vatauineva, als Urheber des gesamten Sittengesetzes und dessen Rächer anerkannt wird, so sieht man doch keine Verbindung seiner Person mit dem Heroenpaar, den Brüdern Yöälox.
Die Yöälox-Familie rechnet zu den ersten Menschen, also zu den ältesten Vorfahren des Yamana-Volkes. Bevor sie jedoch in dieser Gegend hier landete, hatte sie lange und anhaltende Wanderungen durch die grosse weite Welt vollführt. Hierselbst verblieben sie schliesslich, um die eigentlichen Yamana, die bald danach diese Gegend am Canal Beagle bevölkerten, zu unterrichten: wie man sich gegeneinander zu verhalten hat, wie man miteinander und im Einklang mit der Natur lebt und in der praktischen Lebensführung.
Von unschätzbarer Bedeutung war die Erfindung des Feuers durch die Yöälox-Brüder…, aber auch ersannen sie die Pfeilspitze und auch die Harpunenspitze. Allgemein spricht man nur von dem älteren und dem jüngeren Yöälox. Ihre Schwester aber übertrifft die beiden Brüder noch an Intelligenz und Geschicklichkeit; sie ist es letzten Endes, welche ihren Brüdern die besten Vorschläge macht, welche diese selber nachher mit Erfolg zur Ausführung bringen. Deshalb fragten die Brüder sie immer und immer wieder um Rat, und erbaten sich ihre Anweisungen.
Später gingen die beiden Yöälox zum Firmament hinauf und stehen dort als Sterne am Nachthimmel.
Den kurzen Hinweis möchte ich nicht unterlassen, dass die Persönlichkeit der beiden Heroen manche, unverkennbare mondmythologische Motive aufweist; erinnert sei beispielsweise an das Aufstehen von einem tiefen Schlafe vor der Einführung des eigentlichen Todes.
Quelle: "Das Brüderpaar in der südamerikanischen Mythologie - Von Martin Gusinde
Die hier veröffentlichten Informationen sind nur ein minimaler Auszug für interessierte Leser dieser Website. Wir haben hunderte Bücher und digitale Medien, darunter auch Originalmaterial in Audio- und Videoformaten, studieren dürfen. Für die Hilfe bei der Recherche sowie die Zusendung vieler Bücher, Fotos, Video und Audiodateien sind wir sehr dankbar.
Unser besonderer Dank für die freundliche Unterstützung gilt:
Herrn Wiedmann, Berliner Phonogramm-Archiv,
Historische Klangdokumente der Yamana,
Mitschnitte der Aufnahmen von Martin Gusinde
Stefano Palestini, Professor an der Universität Trento
für Soziologie (für die Beratung zu kultureller Aneignung)
Cristina Calderón & Cristina Zárraga,
Cristina Calderón war die letzte Originalsprachlerin der Yámana (geb. 1928, gest. in 2022). Cristina Zárraga ist ihre Enkelin. Gemeinsam stellten sie ein eigenes Yaghan-Spanisch-Wörterbuch zusammen.
der Sammlung Südamerika, Weltmuseum Wien
dem Kloster St Gabriel, Österreich
Archiv mit Fotos & Artefakten von M. Gusinde
dem „Andean Condor Conservation Project“,
Schutz- & Wiederansiedlungsprogramm für Andenkondore in Peru